– Sie haben die Multikulturalität des deutschen Geistes erwähnt, aber um ganz genau zu sein, tun Sie das, nachdem Sie dank der Migrantenkrise zum Helden der deutschen CSU geworden sind und nach einer Zeit, in der die Bayern bei der Erwähnung Ihres Namens auf Massenversammlungen frenetisch zu applaudieren begannen, während der Vorsitzende der EVP, Manfred Weber, nichts als Superlative auf den Lippen hatte, wenn es um Sie ging. Heute sind Sie keine Verbündeten mehr – um es vorsichtig auszudrücken. Was ist zwischen Ihnen passiert?
– Jede Liebe hat ihre Geschichte, mit ihren Höhen und Tiefen, aber diese persönliche Dimension ist vielleicht nicht das Interessanteste. Es reicht zu wissen, dass Herr Weber Ungarn beleidigt hat, als er sagte, dass er die Präsidentschaft der Europäischen Kommission nicht den ungarischen Stimmen verdanken wolle. Ich war es dem ungarischen Volk schuldig, dass solche Worte nicht ohne Konsequenzen ausgesprochen werden. Weber hätte mit den ungarischen Stimmen Kommissionspräsident werden können, aber er sagte, er wolle das nicht, und dann wurde er es auch nicht. Da es in der Politik auch um persönlichen Ehrgeiz geht, hat ihm das sicherlich einige persönliche Schmerzen bereitet. Aber so ist das Leben nun einmal. Das Persönliche ist nicht alles: Dahinter steckt etwas anderes – und dieses andere ist vielleicht die schwierigste Frage unserer Zeit: Was wollen die Deutschen? Ein deutsches Europa oder ein europäisches Deutschland? Der Unterschied ist enorm.
– Was ist der Unterschied?
– Wenn die Deutschen ein deutsches Europa wollen, bedeutet das, dass sie den anderen Völkern vorschreiben wollen, was sie zu tun und wie sie zu leben haben. Und das ist die Linie, die Manfred Weber eingeschlagen hat. Er will entscheiden, was in Bezug auf Migrationsströme, Familienpolitik und Steuerpolitik richtig und falsch ist. Er will uns, den Ungarn, sagen, wie wir leben sollen. Helmut Kohl tat das Gegenteil: Er wollte ein europäisches Deutschland, er zielte nicht auf Hegemonie, sondern auf Pluralismus. Er hat immer anerkannt, dass auch kleinere Völker das Recht haben, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden.
– Und Angela Merkel strebt, anders als Kohl, die Hegemonie an?
– Wir werden noch lange genug warten müssen, um uns eines Tages mit Gewissheit über den Merkelismus äußern zu können. Ich habe bereits meine Meinung zu diesem Punkt, aber es wird an der Zeit sein, diese Meinung auf die Probe zu stellen. Ich denke, dass die Merkelsche Zeit, die sechzehn Jahre dauerte, eine Übergangszeit war. Zu Beginn dieser Zeit wollten die Deutschen den anderen europäischen Nationen noch nicht vorschreiben, wie sie zu leben hatten, denn die deutsche CDU hatte noch einen klaren Charakter, der sie vom europäischen liberalen Mainstream unterschied. Helmut Kohl hatte noch den Mut, mit dem europäischen liberalen Mainstream zu debattieren, und scheute sich auch nicht, mit der liberalen Presse zu diskutieren. Aber nach ihm war Schluss damit. Heute gibt es keinen Unterschied mehr zwischen der Doxa des liberalen Mainstreams und der Meinung der deutschen Christdemokraten. Die Ursache für dieses Abdriften ist, dass Angela Merkel, da die Christdemokraten nicht mehr mehrheitsfähig waren, in Form einer großen Koalition regieren musste. Darf ich einen Exkurs machen, damit Sie es besser verstehen?
– Einen deutschen Exkurs?
– Ja, als ich 1998 zum ersten Mal ministerpräsident wurde, war ich 35 Jahre alt. Ich war bereits seit zehn Jahren in der Politik, aber ich hatte noch nie eine Regierung geführt. Ich rief Helmut Kohl an und fragte ihn als erfahrene europäische Führungspersönlichkeit, ob er mit mir sprechen und mir sagen würde, welche Regeln er bei dieser Aufgabe für wichtig hält. „Natürlich“, antwortete er, „kommen Sie her, ich stehe Ihnen zur Verfügung.“ Wir haben uns viele Stunden lang unterhalten.
– Was hat er Ihnen gesagt?
– Eine sehr wichtige Sache: es sind die ungarischen Wähler, die Sie an die Macht gebracht haben, also sind Sie in erster Linie den Ungarn gegenüber verantwortlich, und Sie dürfen sich in dieser Hinsicht von niemandem einschränken lassen. Gleichzeitig sagte er mir, dass ich verlangen sollte, dass meine Meinung in Europa berücksichtigt wird. Genauer gesagt: indem ich versuche, mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs im Gleichschritt zu sein, mir aber niemals von irgendjemandem vorschreiben lasse, was ich zu tun habe oder wie ich es tun soll.
– Das ist ein Rat, den Sie offensichtlich befolgt haben.
– Aber er sagte mir auch, dass ich, wenn ich als Regierungschef erfolgreich sein wolle, gleichzeitig Parteivorsitzender sein solle. Ich habe diesen Rat nicht befolgt: Ich gab den Parteivorsitz auf – und verlor die nächste Wahl.
– Heute würde sich Helmut Kohl wahrscheinlich wundern, wenn die alten Allianzen aufgelöst und neue gebildet würden. Anfang des Jahres verließ der Fidesz die Europäische Volkspartei (EVP) und kündigte an, zusammen mit der polnischen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) sowie mit Matteo Salvinis Lega ein neues Bündnis zu gründen, das die traditionellen christlichen Werte vertreten soll. Was ist Ihr Ziel? Wollen Sie eine neue Fraktion im Europaparlament gründen oder eine neue europäische Bewegung zur Umgestaltung der Europäischen Union ins Leben rufen?
– Als der Fidesz die EVP verließ – oder, wie wir gerne sagen: als die EVP uns verließ – stellte sich ein wichtiges Problem: Sollten wir am Leben der europäischen Parteien teilnehmen? Am Ende haben wir uns dafür entschieden, schon allein deshalb, weil Parteienstreitigkeiten auf europäischer Ebene am Ende immer auch Auswirkungen auf die nationale Politik haben. Das ist ein Vorteil, den wir unseren Gegnern nicht zugestehen wollten. Was wir jetzt klären müssen, ist: Was wollen wir politisch von Europa? Unsere Antwort auf diese Frage lautet: Wir wollen Brüssel verändern.
– Was genau meinen Sie damit?
– In seiner jetzigen Form ist Brüssel nicht in der Lage, angemessene Antworten auf die Probleme der Menschen zu geben. Die Migrantenkrise war ein Paradebeispiel dafür, aber das war schon 2008 der Fall, als die Reaktion Brüssels auf die Finanzkrise ebenso wenig überzeugend war. Wir in der EVP hätten Brüssel gerne umgestaltet, aber die EVP hatte nicht den Mut dazu. Also müssen wir jetzt eine neue politische Gemeinschaft schaffen, die Brüssel beeinflussen kann, und daran arbeiten wir jetzt – mit Polen, Italienern, Spaniern und vielen anderen. Langfristig wird sich diese Arbeit in Institutionen niederschlagen, wie auch immer diese genau aussehen mögen.
– Sollte die Lega die nächste Wahl in Italien gewinnen, wäre sie ein ziemlich starker Verbündeter, aber um gesamteuropäischen Einfluss auszuüben, braucht man andere Verbündete. Werden Sie es zulassen, dass politische Figuren wie Marine Le Pen ins Spiel kommen?
– Kooperation bedeutet immer, den Willen mehrerer Akteure in Einklang zu bringen. Keiner von uns kann mit der Forderung an den Tisch kommen, dass nur diejenigen, die uns nahe stehen, Zugang zur Zusammenarbeit haben. Doch an den Tisch dieser Kooperation lädt nicht nur der ungarische Fidesz seine eigenen Verbündeten ein – dieses Recht gehört auch der polnischen PiS und Salvini. Das ist etwas, das wir akzeptieren müssen.
– Wollen Sie damit sagen, dass Sie akzeptieren, dass Marine Le Pen eine Möglichkeit ist – das heißt, dass Sie die Präsenz einer Partei akzeptieren, die Sie einst abgelehnt haben?
– Diese Möglichkeit liegt in der Luft.
– Sie waren es, der vor ein paar Jahren anfing, über den Aufbau illiberaler Länder zu sprechen. Diese Idee hat viele Menschen erschreckt, da viele darin eine Herausforderung für die Gewaltenteilung sehen, die für eine pluralistische Demokratie charakteristisch ist. Sind ihre Ängste berechtigt?
– Nein, sie sind es nicht. Ich denke, es ist genau das Gegenteil. Gegenwärtig gibt es keine liberale Demokratie, sondern nur liberale Nicht-Demokratien, die zwar Liberalismus, aber keine Demokratie enthalten. Liberale streben eine Hegemonie über das Gewissen an. Dafür ist die politische Korrektheit da, mit der sie Konservative und Christdemokraten mit dem Bannfluch zu belegen und ins Abseits zu stellen versuchen. Ich hingegen kämpfe gegen die Liberalen und für die Freiheit. Wir stehen nicht auf der gleichen Seite der Barrikade: Ich bin auf der Seite der Freiheit – sie sind auf der Seite der Hegemonie über die Gewissen. Ihre Frage eröffnet aber auch eine andere Dimension: Europa hat in den letzten hundert Jahren unter der Bedrohung durch zwei totalitäre Gefahren gelebt: Nationalsozialismus und Kommunismus. Infolgedessen haben sich Konservative und Christdemokraten mit den Liberalen, vereint in der Verteidigung der Demokratie, solidarisiert. Ab 1990 begannen diese Verbündeten, sich voneinander zu distanzieren, weil wir in einer Reihe von wichtigen Fragen – wie die der Familie, der Einwanderung, der Rolle der Nationen und der Bildung – diametral entgegengesetzte Ansichten haben. Unter diesem Gesichtspunkt bin ich illiberal, und deshalb habe ich den Begriff „antiliberal“ nicht verwendet. Die Liberalen würden sich irren, wenn sie uns nur als Feinde sehen würden: Seit hundert Jahren sind wir ihre Verbündeten.
– Wenn Sie es so ausdrücken, klingt es natürlich; aber dennoch: Wie erklären Sie sich, dass die Verwendung dieses Begriffs – so wie Sie ihn definieren – solche negativen Reaktionen hervorgerufen hat?
– Dadurch, dass es ein kompliziertes Thema ist, und die moderne Politik heute den Geschmack an dieser Art von tiefgreifenden Debatten verloren hat. Der Raum für argumentative Politik ist reduziert worden. In der Politik geht es heute nicht mehr um Überzeugung, sondern um Slogans, Parolen und Mobilisierung. Deshalb ist die europäische Politik heute viel oberflächlicher als noch vor dreißig Jahren.
– Was würde der Viktor Orbán aus dem Jahr 1992 von der Gründung des illiberalen Staates halten, der sich gegen die nationalkonservative Regierung József Antalls stellte und sich zu antiklerikalen Ansichten bekannte?
– Jede Politik muss mit der Elle ihrer Zeit messen lassen. Welche waren die damaligen Maßstäbe ? Es gab die von der kommunistischen Einheitspartei geerbten Parteien, die auf die Rolle der Opposition reduziert waren, und in der Regierung die Konservativen. Die Frage war, ob diese neuen Parteien in der Lage sein würden, die Rückkehr der Postkommunisten an die Macht zu verhindern. Was uns betrifft, so haben uns die Konservativen nicht in die Regierung gerufen, also blieben wir in der Opposition. Aber wir wollten uns nicht dem postkommunistischen Lager anschließen. Die große liberale Partei jener Zeit schloss sich ihnen an und beging damit moralisch Selbstmord. Wir sind nicht hingegangen: Wir waren in Opposition zu den Konservativen und kämpften dafür, die Rückkehr der Postkommunisten an die Macht zu verhindern. Was leider nicht verhindert werden konnte. Das führte dazu, dass wir eine gemeinsame Front mit allen demokratischen Kräften bildeten, was uns 1998 ermöglichte, die Postkommunisten von der Macht zu vertreiben. Natürlich haben wir seitdem unsere Ansichten zu verschiedenen ideologischen Fragen geändert, aber es gibt immer noch eine Kontinuität: Heute wie damals stehen wir auf der Seite der Freiheit, und wir kämpfen gegen die Postkommunisten – das hat sich nicht geändert.
– Können Sie uns in aller Kürze sagen, wie Sie sich in den letzten dreißig Jahren verändert haben?
– Das ist schwer zu sagen. Mir fehlt die Objektivität in dieser Angelegenheit. Was wissen wir heute, was wir damals nicht wussten? Wir wissen, dass die Rolle der Kirchen in der Gesellschaft wichtiger ist, als wir damals annahmen. Wir wissen auch, dass ohne Zusammenarbeit zwischen den Staaten Mitteleuropas keiner von ihnen in der Lage ist, seine eigene Souveränität zu schützen. In den 1990er Jahren war das alles noch nicht so offensichtlich. Wir haben auch nicht erwartet, dass das westliche Modell in dem Maße ausgeweidet werden könnte, wie es 2008, zur Zeit der Finanzkrise, der Fall war. Das war der Moment, in dem die tragende Wand der westlichen Wirtschaft einen großen Ruck erlitt, während die Migrantenkrise die tragende Wand der westlichen Gesellschaften erschütterte. In den 1990er Jahren konnte die Anziehungskraft des Westens nicht in Frage gestellt werden. Ich für meinen Teil respektiere den Westen, und wir bemühen uns, uns in ihn zu integrieren, aber ich muss sagen, dass die Länder westlich von Ungarn in den letzten Jahrzehnten die Anziehungskraft verloren haben, die sie einmal hatten. Was mich betrifft, so möchte ich nicht, dass ungarische Kinder in zwanzig Jahren in einem Ungarn leben, das dem ähnelt, was viele Länder in Westeuropa geworden sein werden. Vor dreißig Jahren wussten wir nicht, wie sich die islamische Welt nach Europa ausbreiten würde oder wie China die Weltwirtschaft verändern würde. Und als Angehöriger des lateinischen Christentums haben wir nicht erwartet, welche bedeutende Rolle das orthodoxe Christentum in der Zukunft spielen würde.
– Mit anderen Worten: Denjenigen, die Ihnen vorwerfen, dass Sie sich so sehr verändert haben, entgegnen Sie, dass sich die Welt um Sie herum auf eine viel tiefgreifendere Weise verändert hat?
– Die Dynamik des menschlichen Lebens besteht aus Veränderung und Erhaltung, was auch den Reiz des Lebens in spiritueller Hinsicht ausmacht. Es ist ein fruchtbarer Konflikt. Was uns betrifft, so wollen wir keineswegs hinter der modernen Welt zurückbleiben: Wir sind keine Antimodernisten, wir verstehen, dass sich die Welt verändert und dass sie sich verändern muss. Die Frage ist: Was wollen wir aus unserer Vergangenheit retten, was wollen wir für die Nachwelt sichern? Von diesem Standpunkt aus betrachtet, befinden wir uns in einer Kontinuität. Wir wollen die Freiheit bewahren, die wir als nationale Souveränität auf der Ebene der Nationen und als individuelle Freiheit auf der Ebene des Einzelnen bezeichnen. Das ist es, woran wir festhalten, auch inmitten der modernen Welt.
– Einige Ihrer Kritiker – darunter viele Ihrer ehemaligen Verbündeten aus Ihrer Zeit als Liberaler – sagen, dass es die Macht ist, die Sie verändert hat. In den 1990er Jahren, als Vladimír Mečiar in unserem Land regierte, waren wir das Ziel der Kritik der Europäischen Union: Sie sagten, dass Demokratie und Pressefreiheit in der Slowakei in Gefahr sind und dass Mečiar einen autoritären Staat aufbaut. Heutzutage werden diese gleichen Etiketten auf Sie angewendet. Man spürt, dass die Formulierung dieser Kritik in erster Linie die Handschrift des linksliberalen Establishments trägt und dass sie ideologischer Natur ist. Andererseits erkennen aber auch in der Slowakei verschiedene konservative Ungarn an, dass beispielsweise die öffentlich-rechtlichen Medien völlig auf der Seite der Regierung stehen, vergleichbar mit dem, was wir zu Hause in der Mečiar-Ära gesehen haben. Die Frage ist also, ob Sie Ihre Kontrolle über verschiedene Bereiche des Staates nicht missbraucht haben?
– Ich kenne das slowakische öffentliche Fernsehen nicht, aber ich kenne das deutsche und britische öffentliche Fernsehen. Und ich wage zu behaupten, dass das ungarische öffentlich-rechtliche Fernsehen seine Regierung weniger unterstützt als der deutsche öffentlich-rechtliche Dienst es tut.
– Viele Ungarn sind der Meinung, dass es eher so ist, wie es unter János Kádár war.
– Ich habe selbst unter János Kádár gelebt, und ich würde ihnen sagen, dass es nicht mehr so ist, wie es damals war. Unter Kádár musste man seine Meinungen illegal drucken und im Geheimen verbreiten. Heute kann jeder unserer slowakischen Freunde nach Ungarn kommen, in einen Zeitungsladen gehen und sagen, dass er alle Zeitungen haben will, die Orbán und seine Regierung beleidigen: Man wird ihm etwa acht Zeitungen und Zeitschriften verkaufen. Lassen Sie uns über die Presse reden, aber lassen Sie uns ernsthaft darüber reden. Die ungarische Politik ist um zwei ideologische Strömungen herum organisiert. Der eine ist liberal, der andere ist Christdemokrat. Wenn Sie sich die kommerziellen Fernsehsender ansehen, ist der eine liberal, der andere konservativ. Oder schauen wir uns die großen Online-Nachrichtenportale an. Ein oder zwei sind konservativ, während sechs im liberalen Lager sind. In der Kategorie der überregionalen Tageszeitungen: die größte ist liberal, die zweitgrößte ist konservativ. Und, wenn man sich die politischen Wochenzeitungen anschaut: zwei konservative, vier liberale. Mit anderen Worten: In den privatwirtschaftlichen Medien finden Sie keine Hegemonie, sondern eine Menge Pluralismus.
– Kritiker sagen auch, dass dieses Gleichgewicht zwischen liberalen und konservativen Medien unter politischem Druck erreicht wurde.
– Als ich an die Macht kam, war die Medienbilanz eins zu neun zugunsten der Liberalen. Jetzt ist es Halbe-Halbe. Meine Kritiker behaupten, dass ich es war, der das Verhältnis geändert hat, aber ich war es nicht. Ich habe öffentlich gesagt, dass ich christliche Geschäftsleute dazu aufrufe, nicht das Verhältnis von eins zu neun zu akzeptieren, das am Anfang herrschte. Ich habe sie dazu gedrängt, konservative christdemokratische Medienprojekte zu gründen. Dies ist nicht die Aufgabe des Staates, sondern des privaten Kapitals. Und so wurden viele konservative Medien gegründet.
– Noch einmal zurück zur Frage der öffentlich-rechtlichen Medien: Stimmt es nicht, dass Sie behaupten, diese Medien seien nicht dazu da, die Regierung zu kritisieren?
– Die Arbeit der öffentlich-rechtlichen Medien ist die Arbeit von Journalisten, denen ich keine Anweisungen geben kann und will. Andererseits scheint es mir normal, dass, wenn die Regierung konservativ ist, diese Ausrichtung auch in den öffentlich-rechtlichen Medien dominiert. Ich kann ihnen keine Anweisungen geben. Aber wenn sie über das Leben des Landes berichten wollen, können sie die Tatsache nicht ignorieren, dass es eine christdemokratische Regierung ist, die im Zentrum der politischen Szene steht. Als Ungarn eine liberale Regierung hatte, neigte das öffentlich-rechtliche Fernsehen dazu, die Interpretationen der liberalen Regierung zu übernehmen – und das, ohne dass konservative und christliche Ideen einen Platz zum Ausdruck fanden, sogar im privaten Sektor! Aber da dies meiner Meinung nach das Wesen der öffentlich-rechtlichen Medien ist, liegt der Schlüssel zum Problem nicht im öffentlichen Sektor, sondern darin, ob es Medien außerhalb dieses Sektors gibt. Ganz zu schweigen davon, dass die Zuschauerzahlen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nur einen winzigen Bruchteil derer des kommerziellen Fernsehens ausmachen – ganz zu schweigen von der Welt der Online-Medien. Heutzutage kann jeder ein Journalist, ein Reporter sein: Solange er ein Smartphone hat, kann jeder seine eigenen Nachrichten erstellen. Zusammenfassend würde ich sagen, dass die Mediensituation in Ungarn heute fair ist.
– Wir slowakischen Journalisten fanden es merkwürdig, dass der ungarischen Presse verboten wurde, aus Krankenhäusern über die Situation der Covid-Epidemie zu berichten. Das ist etwas, was in der Slowakei unvorstellbar wäre. Ist das nicht ein Maulkorb, der den Journalisten – auch denen in der Privatwirtschaft – aufgesetzt wurde?
– Wir haben keine Anweisungen an Journalisten gegeben, sondern an Krankenhäuser. Und unsere Anweisungen lauteten, dass der Zugang zu Krankenhäusern generell verweigert werden sollte – auch für Journalisten. Viele Länder haben das gleiche getan. Wir haben klare Entscheidungen getroffen: Die Verantwortlichen für die Bekämpfung der Epidemie wurden auch angewiesen, die Presse täglich mit allen notwendigen Informationen zu versorgen. Aber solange sich die Krankenhäuser in einer epidemischen Situation befinden, darf niemand einen Fuß in sie setzen. Wie können Journalisten eingelassen werden, wenn nicht einmal die Angehörigen von Patienten eingelassen werden?
– In der Slowakei ist die ungarische Minderheit seit dem vergangenen Jahr zum ersten Mal seit 30 Jahren nicht mehr im Parlament vertreten. Wie erklären Sie sich das?
– Dies ist ein heikles Thema. Staatliche, politische und nationale Grenzen sind nicht deckungsgleich. Der Ungar, der auf dem Gebiet der Slowakei lebt, mit seinen Kindern ungarisch spricht, ungarische Literatur liest, die ungarischen Medien verfolgt, dieser Ungar lebt in einer Kulturgemeinschaft, die er mit den Ungarn im Allgemeinen teilt. Deshalb müssen wir, die wir im so genannten „Mutterland“ (anyaország) leben, eine Politik betreiben, die diese kulturelle Einheit stärkt, ohne in die Souveränität des Nachbarlandes einzugreifen.
– Allerdings kann man wohl sagen, dass Budapest eigene Interessen in der Südslowakei hat.
– Das Interesse Budapests ist, dass die in der Slowakei lebenden Ungarn ihre eigenen Interessen in Pressburg verteidigen können, damit wir sie nicht vor Budapest aus verteidigen müssen. Wenn es der ungarischen Gemeinschaft in der Slowakei gut geht und sie es schafft, ihre Interessen zu verteidigen, dann ist das gut für die Slowaken, und auch für uns. Im Moment läuft es schlecht.
– Der Einfluss des Fidesz in den südlichen Regionen der Slowakei hat jedoch in den letzten zehn Jahren eine noch nie dagewesene Intensität erreicht. Während die MKP Béla Bugár vorwirft, die ungarische Sache zu verraten und zur Assimilierung der Ungarn in der Slowakei beizutragen, entgegnet Bugár, dass er kein Vasall des Fidesz werden will, und Kreise, die mit seiner Partei Most-Híd verbunden sind, üben scharfe Kritik an dem Geld, das über Ausschreibungen in der Südslowakei gelandet ist. Das Etikett des Verräters, das Bugár angeheftet wurde, spiegelt wahrscheinlich die Realität der innenpolitischen Konflikte in Ungarn wider…
– …das sind viel zu harte Ausdrücke. Ich kann verstehen, dass Béla Bugár nicht stolz darauf wäre, als unser Freund angesehen zu werden, aber es gibt viele Ungarn, die das Gleiche für ihn empfinden, nur umgekehrt. Dies ist eine Debatte unter den Ungarn, die sehr anfällig für interne Streitigkeiten sind. Nur sprechen wir hier über die Ungarn in der Slowakei, und es liegt an ihnen, den Rahmen zu finden, in dem sie ihre eigenen Interessen verteidigen wollen, sei es in Form einer gemischten Partei, sei es durch den Beitritt zu einer großen Partei, sei es durch eine eigene ungarische Partei.
– Legt der Fall Most-Híd nicht nahe, dass es im Interesse des Fidesz wäre, wenn alle Ungarn in der Slowakei in der gleichen Partei wären?
– Es liegt im Interesse des Fidesz als nationaler Partei, dass auch in der Slowakei viele ungarische Kinder geboren werden, dass ihre Mütter mit ihnen Ungarisch sprechen, dass sie eine ungarische Schule besuchen, dass ihnen niemand weh tut, wenn sie Ungarisch sprechen, und dass sie frei sind, eine politische Vertretung zu haben. Die Frage, wie sie dies tun werden, ist zweitrangig. Deshalb unterstützen wir die kulturelle Identität, nicht die politischen Interessen.
– Es gab jedoch Zeiten, in denen es aufgrund Ihrer politischen Pläne zu ernsthaften Spannungen kam, sofern sie auf die Ungarn im eigenen Land abzielten – sei es der Plan für ein „Magyaritätszertifikat“ (magyarigazolvány) oder, vor zehn Jahren, der Plan für die doppelte Staatsbürgerschaft. Tatsache ist, dass Sie in letzter Zeit solche Themen micht mehr erwähnt haben – so wie es im Vorjahr überraschend war, dass die Gedenkfeier zum 100. Jahrestag des Vertrags von Trianon fast konfliktfrei verlief. Könnte es sein, dass diese Themen in Ihrem Land nun ihr politisches Potenzial ausgeschöpft haben?
– In Rumänien zum Beispiel, wie auch in Serbien und Kroatien, wird die doppelte Staatsbürgerschaft als ein gutes rechtliches Instrument angesehen, das die Koexistenz von gegensätzlichen Ansichten erleichtert. Sie in der Slowakei haben eine andere Meinung, und das ist Ihr gutes Recht: Ich teile Ihre Meinung in dieser Sache nicht, aber ich nehme einfach zur Kenntnis, dass Sie ein solches Rechtsinstrument nicht nutzen wollen. Und wir hoffen, dass Sie eines Tages Ihre Meinung ändern werden, im Lichte der Beispiele aus anderen Ländern. Aber das ist kein Grund, Spannungen zu erzeugen.
– Ist es nicht vielmehr so, dass die Migrantenkrise, die Ungarn unter Ihrer Führung bewältigt hat, die Haltung Ungarns gegenüber der Europäischen Union und Mitteleuropa so verändert hat, dass Sie diese irritierenden Themen nicht mehr diskutieren wollen?
– Ich werde die Nachbarn Ungarns immer bitten, dafür zu sorgen, dass die auf ihrem Boden lebenden Ungarn eine Heimat haben, die sie respektiert. Wann immer ich das Gefühl habe, dass ihre Rechte verletzt werden, werde ich mich auf die richtige Art und Weise darüber beschweren. Aber das Gewicht dieser Probleme ist jetzt viel geringer als die Frage nach dem Schicksal unserer gesamten Region. Denn wenn wir keine Solidarität zwischen Slowaken, Ungarn, Tschechen und Polen zeigen, wenn wir es nicht schaffen, mit einer Stimme sowohl zum Westen als auch zum Osten zu sprechen, werden wir alle verlieren.
– Was meinen Sie damit?
– Was ich jetzt sagen werde, mag für slowakische Ohren ein wenig beleidigend sein, aber wir Ungarn glauben, dass es in Mitteleuropa eine Lektion gibt, die alle Völker der Region lernen sollten. Am Ende des Zweiten Weltkriegs standen die Völker Mitteleuropas, unabhängig davon, auf welcher Seite sie gekämpft hatten, alle auf derselben Seite. Diejenigen, die sich der richtigen Seite angeschlossen hatten, erhielten als Belohnung genau das, was wir, die auf der falschen Seite gekämpft hatten, als Strafe erhielten. Wir leben einfach in einer Schicksalsgemeinschaft. Die Frage ist, wer die Einheit Mitteleuropas organisiert: die Deutschen, die Russen, die Amerikaner – oder wir, die dort leben?
– Ist es nicht in Wirklichkeit so, dass es Viktor Orbán ist, der sie organisieren will?
– Ein solches Projekt wäre nicht realistisch: Das Flaggschiff ist Polen. Ohne Polen haben die anderen Länder der Region kein Gewicht. Wenn Polen die V4 verlassen würde, würde die V4 zu einem Schiff ohne Kiel. Die Slowakei hat auch eine Schlüsselrolle in dieser Konstruktion – obwohl ich mir nicht sicher bin, dass alle Slowaken das verstehen.
– Was meinen Sie damit?
– Es ist wichtig, dass die V4 sowohl im Norden als auch im Süden handeln kann. Im Norden sind es die Polen, im Süden die Ungarn. Aber der Norden muss mit dem Süden verbunden sein, denn ohne Sie würden wir in zwei Teile zerbrechen. Deshalb habe ich dem slowakischen Ministerpräsidenten immer geraten, den Nord-Süd-Verbindungen Priorität einzuräumen: Uns fehlen Autobahnen, Eisenbahnen, und selbst Gasleitungen werden entlang anderer Achsen gebaut.
– Doch die Slowaken sehen sich eher als Brücke zwischen Ost und West als zwischen Nord und Süd. Die V4 ist zudem ernsthaft gespalten, was ihr Verhältnis zu Russland und Putin angeht. Die Polen sind mächtig russophob, die Slowakei und Ungarn sehen das anders, und was Tschechien betrifft, so ändert sich dort gerade die Stimmung nach der Vrbětice-Affäre. Ist es nicht Wladimir Putin, der das Risiko eingeht, die V4 zu spalten?
– Unterscheiden wir zunächst einmal zwischen Russland und der Person des russischen Präsidenten. Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass dieses Problem von seiner Person abhängt: Für uns ist es ganz einfach Russland, das ein geopolitisches Problem darstellt. Ja, die Polen haben eine klare russenfeindliche Politik, während Sie – zumindest in unserer Wahrnehmung in Ungarn – als eher russophil gelten. Was das tschechische politische Denken betrifft, so hat es immer ein panslawistisches Element enthalten. Wir Ungarn haben den Eindruck, dass es für die Russen leichter ist, mit slawischen Ländern zusammenzuarbeiten als mit uns. Ganz zu schweigen davon, dass wir das einzige Land sind, das 1956 gegen Sowjetrussland in den Krieg zog. Niemand sonst hat es geschafft – es ist eine der heroischen Episoden unserer nationalen Geschichte.
– Wie wollen Sie die V4 zusammenbinden, wenn wir in unserer Haltung zu Russland gespalten sind und gespalten bleiben werden?
– Die beste Antwort ist der Blick auf eine Karte. Es ist ganz klar, dass Polen, das inmitten eines riesigen flachen Gebiets liegt, Sicherheitsgarantien braucht. Die Slowakei, Ungarn und die Tschechische Republik leben im Schutz der Karpaten; auch wir brauchen natürlich Garantien, aber wir leben nicht, wie sich die Polen fühlen, unter einer russischen Bedrohung. Deshalb ist es für uns wichtig, das Bedürfnis Polens nach Sicherheitsgarantien mit den Erfordernissen der ungarisch-russischen Zusammenarbeit innerhalb der V4 in Einklang zu bringen. Mit anderen Worten: Jeder der V4-Mitgliedsstaaten wird selbst entscheiden, wie er seine Russlandpolitik gestaltet, aber wir müssen in der Lage sein, uns gegenseitig Garantien zu geben, auch gegenüber Russland. Nun, da die Tschechen uns um eine Solidaritätserklärung gebeten haben, unabhängig davon, was ich persönlich von den fraglichen Ereignissen halte, haben wir den Tschechen sofort die Solidarität gezeigt, die sie von uns erwarten…
– … auch wenn Sie die Vrbětice-Affäre ganz anders wahrnehmen?
– Ich fragte die tschechischen Verantwortlichen: Ist das, was ich gelesen habe, wirklich passiert? Die Antwort war: „höchstwahrscheinlich“. Dies ist meine Meinung zu dieser Situation.
– Heutzutage ist es die NATO, die Polen diese Art von Garantien bietet; oder stellen Sie sich vielleicht vor, dass die V4 Polen eine besondere Garantie bietet?
– Ja, im Rahmen der NATO werden diese Garantien Wirklichkeit; was die europäische Verteidigung angeht, so können wir im Moment nur davon träumen. Aber Verteidigung ist keine Angelegenheit von Träumen: Sie ist die härteste aller Realitäten, die Konfrontation von Angesicht zu Angesicht mit brachialen Kräften.
– Mit anderen Worten: Ihre Antwort wäre eine gemeinsame europäische Verteidigung, die eine Aura der Macht schafft?
– Aus unserer Sicht ist die Russlandpolitik der Union primitiv: Sie kann nur Ja und Nein sagen. Wir hingegen brauchen eine gemeinsame europäische Verteidigung. Wir hingegen brauchen eine nuancierte Politik, die auf dem Verständnis beruht, dass Russland ein sehr starker Staat ist, der auch Stärke respektiert. Das heißt, wenn wir militärisch nicht mithalten können, wird Russland eine Gefahr für uns sein. Auf der anderen Seite müssen wir im wirtschaftlichen Bereich kooperieren. Aber was wir tun, ist genau das Gegenteil: Wir versuchen, durch eine Politik der Wirtschaftssanktionen Stärke zu zeigen, während wir militärisch weich bleiben. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir tun sollten.
– In der Europäischen Union werden Sie als ein Mann gesehen, der die EU und ihre Institutionen schwächt – ja sogar versucht, sie zu zerstören. Und Sie sind es, der uns jetzt sagt, dass Sie, um das russische Problem zu lösen, den Aufbau einer starken europäischen Verteidigung wünschen?
– Ja, denn meiner Meinung nach lauten die Koordinaten des Problems nicht: entweder die EU vorbehaltlos unterstützen oder sie komplett ablehnen. Es gibt Elemente in der EU, die gestärkt werden sollten – aber auch das Gegenteil ist der Fall, insbesondere im Fall des Europaparlaments, das eine absolut schädliche Rolle spielt, indem es Parteien zur Grundlage der europäischen Politik macht, was die europäische Linke ausnutzt, um die Souveränität der Staaten anzugreifen. Die Frage lautet also nicht: Ja oder Nein zur EU – sondern: welche EU?
– Der Mann, der Sie intellektuell ausgebildet hat, István Stumpf, sagte kürzlich, dass die Europäische Union bis 2030 entweder eine Föderation, eine Gemeinschaft von Nationalstaaten, werden oder aufhören sollte zu existieren. Was ist Ihre Vorhersage für 2030?
– Dies ist eine Frage, die einmal mehr die Bedeutung der Slowakei unterstreicht. Was die Slowakei zu einem Schlüsselstaat macht, ist nicht nur ihre Fähigkeit, den Norden und den Süden in Europa zu verbinden, sondern auch die Tatsache, dass Sie der einzige mitteleuropäische Staat sind, der sich auf das als Eurozone bekannte Experiment eingelassen hat. Die Ergebnisse Ihres Experiments sind wertvoll für uns, die wir derzeit nur externe Beobachter sind, die sich die Frage stellen: Ist die Währungsintegration für eine Nation eine gute oder eine schlechte Sache?
– Ich bin sicher, dass Sie, wie wir, Wirtschaftsanalysten und Politologen haben, die diese Frage beantworten können.
– Natürlich, ja; und sie sind unterschiedlicher Meinung. Aber um auf Ihre Frage nach der Zukunft der Union im Jahr 2030 zurückzukommen: Das Einzige, dessen ich mir sicher bin, ist, dass kein „europäisches Volk“ entstehen wird – in der Zukunft wie in der Vergangenheit wird es Ungarn, Slowaken, Deutsche, Franzosen … Europa wird auch ein starkes islamisches Element enthalten, aber es wird kein „europäisches Volk“ geben. Es wird Nationen geben, es wird Staaten geben, und es wird an ihnen liegen, einen modus vivendi zu finden – äquivalent zu dem, was wir heute die Europäische Union nennen. Das Wesentliche ist jedoch nicht die Institution, sondern die Absicht. Im Jahr 2030 werden wir sicherlich kooperieren – die Frage ist, was dann mit uns geschehen wird.
– Woran denken Sie?
– Westeuropa befindet sich inmitten eines kulturellen Wandels: Migranten und Muslime sind bedeutende Minderheiten, während sich die einheimische Bevölkerung, die sich vom Christentum losgesagt hat, auf eine post-christliche, post-nationale Gesellschaft zubewegt. Die Frage ist, ob solche Gesellschaften in der Lage sein werden, ein stabiles Westeuropa zu bilden.
– Glauben Sie, dass sie es nicht tun?
– Ich persönlich habe viel mehr Vertrauen in die Zukunft Mitteleuropas als in Westeuropa. Ich bin überzeugt, dass unsere Kinder besser leben werden als wir. Wir werden in Mitteleuropa eine große Renaissance erleben, wirtschaftlich, demographisch, sicherheitspolitisch und kulturell. Ich bin optimistisch. Aber ob Westeuropa bis 2030 stabil bleiben wird, ist die spannendste Frage der unmittelbaren Zukunft.
– Wollen Sie wirklich Mitteleuropa auf ein Leben ohne die Europäische Union vorbereiten?
– Ich würde es so ausdrücken: Bis jetzt drehte sich die Europäische Union um eine deutsch-französische Achse, in einem bipolaren Modus der Zusammenarbeit. Was wir jetzt anstreben, ist ein Europa, das bis 2030 einen dritten Pol haben wird: Mitteleuropa, also die V4. Der Handel zwischen den V4 und Deutschland ist doppelt so groß wie der Handel zwischen Frankreich und Deutschland und dreimal so groß wie der zwischen Deutschland und Italien. In den letzten Jahren ist diese Tripolarität in den Debatten um die Zuwanderung oder den Haushalt gut zu beobachten – und für mich ist das das Bild der Zukunft.
– Jahrzehntelang war die ungarische Politik eine Geisel von Trianon, so sehr, dass József Antall einmal sagte, er habe das Gefühl, der Ministerpräsident von 15 Millionen Ungarn zu sein. Aber wenn man Ihnen jetzt zuhört, hat man den Eindruck, dass Sie nicht mehr in diesem Trianon-Trauma leben, sondern eine neue europäische Mission für das ungarische Volk gefunden haben.
– Wir mögen dieses Zitat von Antall sehr gerne: Es war ein außerordentlich wichtiger Satz zu dieser Zeit.
– Und heute ist das nicht mehr so?
– Seitdem sind dreißig Jahre vergangen, was diesen Satz nicht kleiner gemacht hat, aber der Horizont hat sich mit ganz anderen Fragen gefüllt, auf die wir Mitteleuropäer nur gemeinsam Antworten finden können, denn wenn wir uns wieder innerhalb unserer nationalen Grenzen verstecken oder die Position des Igels einnehmen, werden wir alle verlieren.
– Sie sprechen von Ihren eigenen Visionen von Mitteleuropa, deren Umfang in Jahrzehnten gemessen wird. Aber Sie laufen Gefahr, die ungarischen Parlamentswahlen im nächsten Jahr gegen eine nun geeinte Opposition zu verlieren: Haben Sie davor keine Angst?
– Wenn ich das Ende dieses Wahlzyklus erreiche, werde ich sagen können, dass ich 16 Jahre an der Macht und 16 Jahre in der Opposition verbracht habe. Was auch immer dann passiert, ich werde schon alles gesehen haben.
– Wenn Sie verlieren, werden Sie versuchen, vier Jahre später wiederzukommen?
– Ich bereite mich auf einen Sieg vor. Wir sind eine große Partei, mit einer Kultur, einem Programm und einer Vision, und es gibt eine Mehrheit der Ungarn, die mehr oder weniger unsere Gefühle und Bestrebungen teilt. Natürlich müssen wir uns auch fragen, inwieweit wir – ihrer Meinung nach – diese Gefühle und Bestrebungen richtig darstellen. Da unsere Präsenz in der politischen Arena als Partei auf tiefen philosophischen und sentimentalen Grundlagen beruht, wird es immer eine Partei wie die unsere geben. In der Zwischenzeit ist eine Generation von Politikern erwachsen: Ungarn, die 15 Jahre jünger sind als wir, die nicht auf die kommunistische Schule gegangen sind, die eine bessere Ausbildung erhalten haben, die mehr Fremdsprachen sprechen, die eine sehr breite Weltanschauung haben und die das Handwerk der Politik von uns bis zur Perfektion gelernt haben. Wenn unsere Generation eines Tages aufhören sollte zu arbeiten, wird sie Nachfolger haben.
– Sicher ist aber, dass sich Angela Merkel auf ihren endgültigen Abschied in sechs Monaten vorbereitet. Sie haben der deutschen Presse gesagt, dass Sie ihren Weggang bedauern. Ist das angesichts des eher hitzigen Streits, den Sie während der Migrantenkrise hatten, als Geste der Höflichkeit gegenüber der deutschen Öffentlichkeit zu sehen, oder bedauern Sie ihren Weggang wirklich?
– Ich persönlich respektiere Merkel, ungeachtet der Tatsache, dass wir in vielen Fragen nicht einer Meinung sind. Es ist eine große persönliche Leistung von ihr, dass es ihr in diesen 16 Jahren gelungen ist, ihre Partei in der Mitte des Regierungsbogens zu halten. Wer nicht in der Branche ist, kann die damit verbundene intellektuelle und moralische Energie nicht einschätzen. Ich bedaure ihr Ausscheiden aufrichtig. Bislang konnte man immer im Voraus wissen, was in Deutschland nach einer Wahl passieren würde: Die Rahmenbedingungen waren stabil. Ich fürchte, dass wir nach ihrem Abgang feststellen werden, dass wir Merkel mehr vermissen werden, als wir dachten.
– Warum?
– Während wir sprechen, ist alles offen. Welche Folgen wird das von den Grünen erreichte Wahlgewicht haben? Hat Deutschland eine neue Generation von Führungskräften, die bereit sind zu handeln? Keiner weiß es.
– Heute, wie auch in anderen Interviews, haben Sie über das Christentum gesprochen, und Sie bezeichnen sich selbst als Christdemokrat. Von der Slowakei aus gesehen scheint Ungarn, anders als Polen, ein säkularisiertes Land zu sein, in dem der Anteil praktizierender Christen relativ gering ist. Wäre Ungarn nicht auch ein postchristliches Land, in dem man eher ein politisches Christentum verewigt, ein bisschen wie Putin in Russland?
– Was mich betrifft, so ist meine Antwort, dass ich ein gläubiger und bekennender Christ bin und der Bruder eines jeden christlichen Slowaken. Was die Politik betrifft, so ist es nicht die Aufgabe christlich-demokratischer Politik, klerikale Dogmen zu verteidigen – deshalb verzichte ich auf den Ausdruck „politisches Christentum“. Die wichtigste Frage unserer Existenz – steuern wir auf Erlösung oder Verdammnis zu? – ist keine politische Frage, auch wenn es die wesentliche Frage des Christentums ist. Aber die Politik ist in dieser Angelegenheit nicht zuständig. Ich spreche also nicht von christlicher Politik, sondern von christlich inspirierter Politik. Ich spreche von der Verteidigung einer Lebensweise, die aus Menschenwürde, Freiheit, Familienleben und nationalen Gemeinschaften besteht. Es gibt politische Tendenzen, die diese Lebensweise angreifen, die sie dekonstruieren wollen, und es ist angemessen, ihnen zu widerstehen. Es geht also nicht um meinen persönlichen Glauben, denn eine christdemokratische Politik ist auch für diejenigen offen, die nicht persönlich religiös sind. Wir sind nicht die Führer einer bestimmten Sekte, sondern einer politischen Partei mit einem Programm.
– Die slowakischen Christdemokraten halten den Schutz des vorgeburtlichen Lebens für ein zentrales Thema, und auch Sie sind dafür, aber in der Praxis haben Sie seit Ihrem Amtsantritt nichts dafür getan. Oder, genauer gesagt, Sie erkennen an, dass es sich um ein grundlegendes Menschenrecht handelt, aber Sie wollen nicht weiter auf dessen Verteidigung eingehen – warum? Glauben Sie vielleicht, dass Sie keine Mehrheit in der Gesellschaft um sich scharen können, die Sie unterstützt?
– Wir stehen ganz klar auf der Seite des Lebens: 2011 haben wir eine neue Verfassung verabschiedet, in der wir ganz klar festgeschrieben haben, was wir bezüglich des Sinns des Lebens für wichtig halten. Eine Politik der Totalverbote, die unter anderem aus moralischer Sicht legitim wäre, wäre in ihren konkreten Ergebnissen kontraproduktiv. In der Politik ist es das Ergebnis, das zählt: Die Absicht ist nicht zu vernachlässigen, aber eine Absicht, der keine Ergebnisse folgen, kann zu einer Katastrophe führen. Innerhalb von 11 Jahren ist es uns gelungen, die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche deutlich zu reduzieren – und das ohne ein vollständiges Verbot. Es ist auch ein Verdienst unserer Regierungen, dass Ungarn jetzt auf der Seite des Lebens steht. Aber die Untersuchung dieses Themas hat uns zu einer anderen Frage von großer Bedeutung geführt: der nach dem Verhältnis von Wahrheit und Mehrheit in der Politik. Dies ist eine äußerst schwierige Frage. Denn wenn die Mehrheit nicht im Dienst der Wahrheit steht, dann ist die Mehrheit wertlos. Wem es aber nicht gelingt, eine Mehrheit für die Wahrheit zu sammeln, der wird auch nicht im Dienste der Wahrheit politisch handeln können.












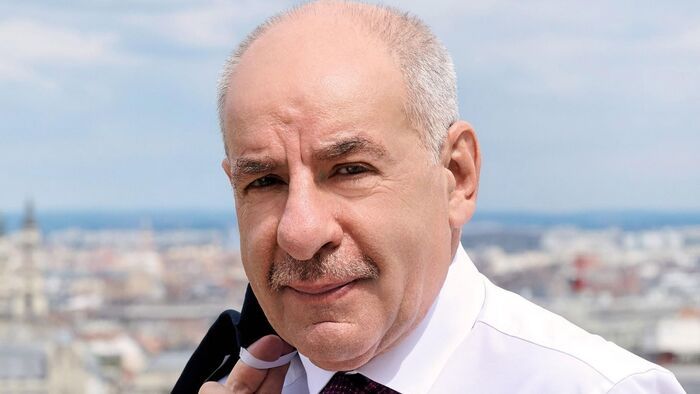






Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!