Die Frage „quo vadis, Unio, quo vadis, Europa?“ wird von der europäischen Öffentlichkeit immer häufiger gefragt – umso mehr, als die derzeitige Kommission unter der (Nicht-)Führung von Ursula von der Leyen im Kampf gegen die Pandemie spektakulär versagt hat – nämlich bei der Organisation einer Impfkampagne auf EU-Ebene. Die mehr als verdächtige Ohnmacht der Kommission im Bereich der Impfungen ist sogar zu einem echten Skandal geworden.
Aber dieses Scheitern ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs: Seit Jahren gibt es viele Bruchlinien, die die Union als Staatenbund spalten und zersplittern. Da ist zum einen das Aufeinanderprallen von Ideologien/Weltanschauungen (globalistischer Liberalismus versus Nationalkonservatismus), zum anderen der tiefe und hartnäckige Streit um die Frage, wie das Phänomen der Migration zu bewerten und zu behandeln sei, zum anderen der Konflikt zwischen Gender-Theorie und traditioneller Familienpolitik, und wieder ein anderer ist der Streit zwischen Föderalismus und nationaler Souveränität – um nur die wichtigsten zu nennen. Ein erschwerender Faktor, der diese Spaltungen vertieft, ist die Tatsache, dass die meisten dieser Bruchlinien zwischen den alten westeuropäischen Mitgliedsstaaten auf der einen Seite und den neuen ost- und mitteleuropäischen Mitgliedsstaaten auf der anderen Seite verlaufen (natürlich mit verschiedenen Ausnahmen auf beiden Seiten – so Dänemark im Westen).
Vor ein paar Wochen beendete ich einen meiner Texte mit folgenden Gedanken: 1951 bestand die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl aus sechs kulturell ähnlichen Ländern auf dem gleichen Entwicklungsstand, und ihre Zusammenarbeit war viele Jahre lang erfolgreich. Heute hingegen gibt es 27 Mitgliedsstaaten, die versuchen, 27 unterschiedliche geopolitische Positionen, 27 wirtschaftliche Entwicklungsstufen, 27 Traditionen, 27 Geschichten und 27 nationale Besonderheiten unter einen Hut zu bringen. Es ist klar, dass dies eine riesige Herausforderung ist und dass sich viele Dinge radikal ändern müssen, wenn die Union geeint bleiben soll – auch wenn die Union nicht dafür bekannt ist, dass sie ihren Kurs sehr schnell ändert: sie ähnelt wohl eher einem riesigen Ozeandampfer.















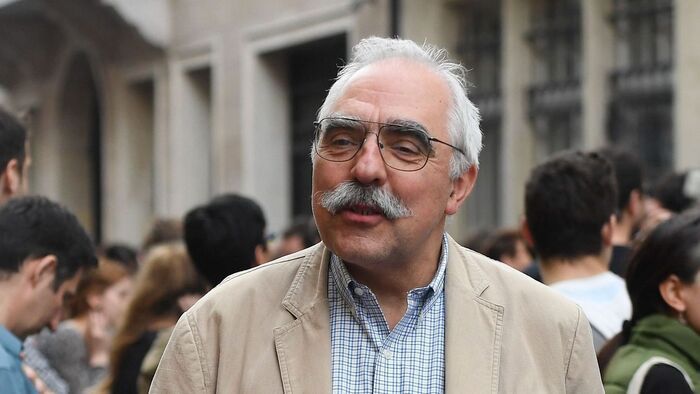



Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!