Die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie (1867-1918) kann sowohl in ihren nicht zu unterschätzenden Erfolgen als auch in ihrem Fall mit tragischen Folgen multinationalen Staaten späterer Epochen als Beispiel dienen und ihnen helfen, das Unglück, das sie erlebt hat, zu vermeiden und an den guten Praktiken festzuhalten, die bereits die ihren waren. Seine beiden legislativen Zentren – der Wiener Reichsrat und das ungarische Parlament – herrschten über fast zwanzig Völker, die sich in Herkunft und Sprache voneinander unterschieden. Ihr gemeinsames politisches Handeln war in der Praxis auf drei Bereiche beschränkt: die Militärpolitik, die Diplomatie und das Finanzwesen – ein Bereich, der mit den ersten beiden in Verbindung stand. Die Bürger dieses Staates – einer der größten in Europa – bewegten sich frei von Lemberg (Lwiw, in der Ukraine) nach Triest und Kronstadt (Braşov, in Rumänien), von Innsbruck und Prag nach Sarajevo.
Der Kaiserhof hatte schnell erkannt, dass die organische Koexistenz dieser Vielfalt nur dann von Dauer sein konnte, wenn über die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit hinaus das Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Heimat zu einer wirklich gelebten spirituellen Erfahrung wurde. Das Studium der Geschichte und der (Volks-)Kultur wurde in den Dienst der Schaffung eines Gemeinschaftserlebnisses auf spiritueller Ebene gestellt. Die mehr als zwanzig illustrierten Bände von Az Osztrák-Magyar Monarchia [„Die Österreichisch-Ungarische Monarchie“], die fast zeitgleich auf Deutsch und Ungarisch erschienen (der Verfasser des ungarischen Textes war der Schriftsteller Mór Jókai), setzten sich zum Ziel „die harmonische Koexistenz zweier Parteien, von denen keine in Zukunft die sie verbindenden Bande lösen oder enger knüpfen will, und deren Entfaltung auf gegenseitiger Verständigung und Zusammenarbeit beruht, gemäß dem Motto ihres obersten Herrschers: Viribus unitis!“
Diese Mäßigung, die die Habsburger damals auszeichnete, war von einem Sinn für politische Realitäten diktiert worden. Sie markierte den Beginn eines beispiellosen kulturellen Aufschwungs: Die bereits bestehende Literatur (österreichische, tschechische, italienische, ungarische) trat in eine neue Epoche ein, während die Literatur von Völkern, die bis dahin kaum über eine literarische Tradition verfügten, in kurzer Zeit Weltspitze erreichte. Die geistige Kraft, die die von der Macht ausgeschlossenen Slawen – und insbesondere die dynamischsten unter ihnen: die Tschechen – antrieb, war jedoch unter dem Zeichen des nationalen Widerstands geboren worden. Wenige Monate vor dem österreichisch-ungarischen Kompromiss hatte der tschechische Historiker und Schriftsteller František Palacký die Möglichkeit einer zwischen Österreichern und Ungarn geteilten Regierung unter Ausschluss der Slawen in einer pessimistischen Skizze skizziert. Die Ausrufung der Doppelmonarchie, so hatte er geschrieben, werde zugleich „der Tag der Geburt des Panslawismus sein, in der am wenigsten erfreulichen Form, die dieser annehmen kann. Wir Slawen bereiten uns darauf vor, mit gerechtem Schmerz, aber ohne Furcht“.




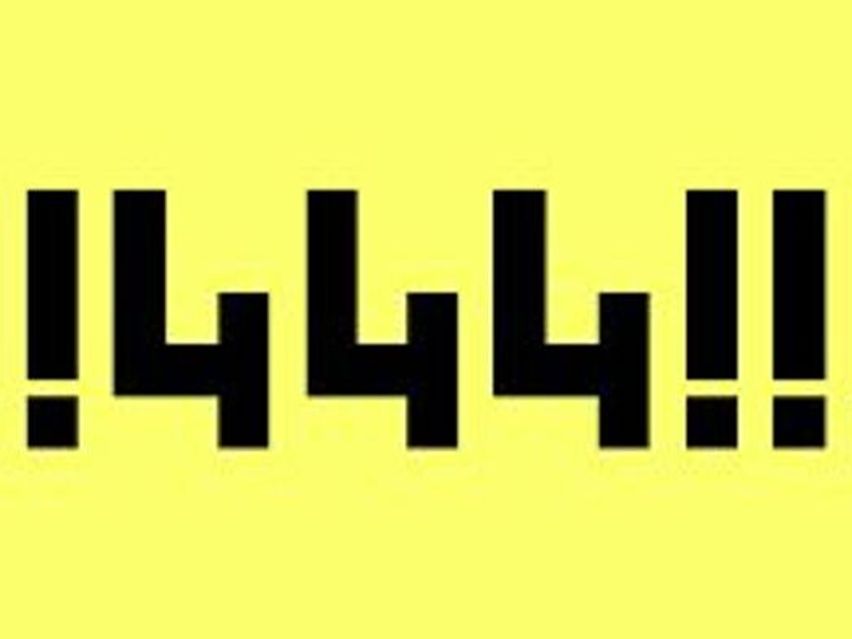














Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!