„Über die Anwesenheit der Polen freut sich jeder Ungar,
Gestern angekommen, ist jeder Pole sein guter alter Freund“.
(János Arany, „Das Mädchen von Erlau“)
„Die Geschichte bietet kein anderes Beispiel für zwei benachbarte Nationen, die in so gutem Einvernehmen zusammenleben“ – behauptete Adorján Divéky, Ungarns angesehener Experte für internationale Beziehungen, bereits 1934 in seinem kleinen Buch, das alles zusammenfasst, was die Ungarn während des Ersten Weltkriegs für Polen getan haben. An dessen Ende geht er auf den Wendepunkt des polnisch-bolschewistischen Krieges im August 1920 ein, als eine Munitionslieferung aus Ungarn zu einem historischen Sieg der Polen beitrug – zum berühmten „Wunder von der Weichsel“.
Und es ist wohl wahr, dass es leicht ist, die Geschichte der beiden Länder in parallelen Erzählungen zu ordnen.
Ungefähr zur gleichen Zeit traten wir – durch Christianisierung und Staatsgründung – der Welt des europäischen Okzidents bei. Das symbolische Datum 966, das die Polen feiern, verweist auf ihre Bekehrung zum Christentum, während unser Datum, das mit der Jahrtausendwende zusammenfällt, das Datum der Krönung des Heiligen Stephans ist. Diese schicksalhaften Jahrzehnte finden ein weiteres gemeinsames Symbol in der Figur des Heiligen Adalbert (der aus dem Land der Tschechen kam), der in beiden Ländern entscheidend dazu beigetragen hat, dass der neue Glaube Wurzeln schlagen konnte. Die Grundlage dieser Schicksalsgemeinschaft ist vor allem die gemeinsame geopolitische Situation, die, so könnte man sagen, von den Anfängen bis heute die gleiche geblieben ist. Eine Situation, die üblicherweise mit den Worten „an der Grenze zwischen Orient und Okzident“ charakterisiert wird. Dieser im späten Mittelalter entstandene Topos macht unsere beiden Länder zu antemurale christianitatis, zum Schutzschild des Christentums gegen die Eindringlinge aus dem Osten (Mongolen, Tataren, Osmanlitürken, Moskowien).
Man braucht nur einen Blick auf eine Karte aus der Mitte des 15. Jahrhunderts zu werfen: von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer die Königliche Republik Polen-Litauen – und auf der anderen Seite der Karpaten das Königreich Ungarn, das sich – zusammen mit Kroatien – bis zur Adria erstreckt. Bei den großen Stürmen in der europäischen Geschichte wehte der Wind meist von Ost nach West. Und auf diesem Breitengrad zog der Hurrikan in der Regel auch vorbei. Zuerst gab die Mauer in Mittelosteuropa im Süden bei Mohács nach; dann, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, im Norden durch die Teilung Polens.


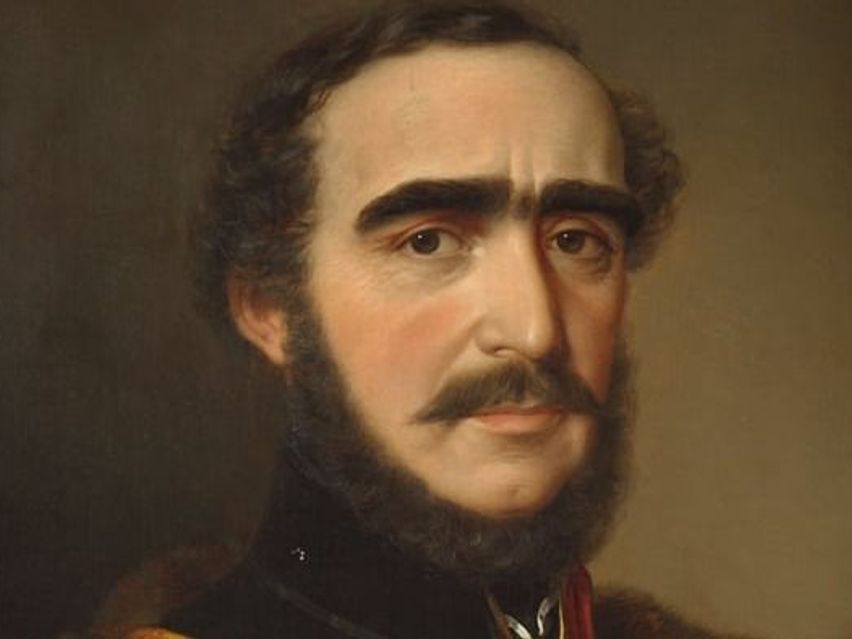




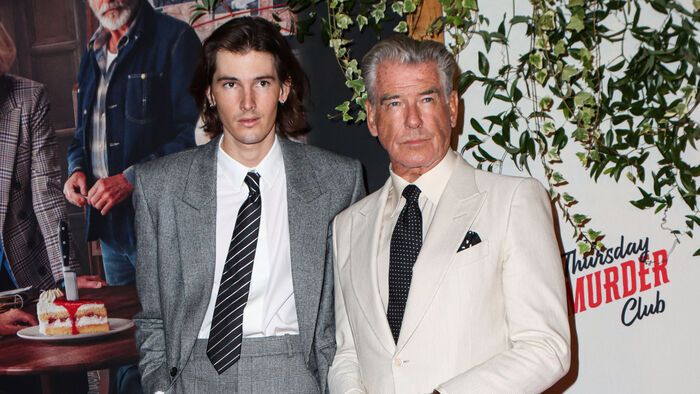











Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!