Ungarn und Serben schreiben eine neue Seite ihrer gemeinsamen Zukunft
Auch wenn es nur wenige wissen, befindet sich eines der ältesten architektonischen Denkmäler der serbisch-magyarischen Beziehungen auf der heute unter dem Namen Csepel (serb. Острво Чепел, AdÜ) bekannten Donauinsel. Die Kirche des Klosters Ráckeve (serb. Ковин, AdÜ) ist eines unserer gut erhaltenen gotischen Bauwerke, das seit 1440 von der serbisch-orthodoxen Kirche genutzt wird. Sie wurde von Ladislaus I. von Ungarn an die serbischen Gemeinden verschenkt, die sich auf der Flucht vor den türkischen Armeen, die die Regionen entlang der unteren Donau verwüsteten, in dieser Gegend niederließen.
Die Tatsache, dass hier, im Herzen Ungarns, während der sechs Jahrhunderte, die seither vergangen sind, trotz aller historischen Rückschläge und aller Schwierigkeiten, die dieses Land durchgemacht hat, eine serbisch-orthodoxe Pfarrgemeinde ohne Unterbrechung weiter funktioniert hat, enthält für uns mehrere Botschaften von großer Bedeutung.
Erstens lehrt es uns, dass Ungarn keine Dozenten von Außen braucht, um ein friedliches Zusammenleben zwischen den Volksgruppen und Religionen auf Dauer zu gewährleisten – obwohl niemand in den vergangenen Jahrhunderten das Bedürfnis hatte, dieses friedliche Zusammenleben mit „Multikulturalismus“ zu bezeichnen.
Eine weitere wichtige Lektion ist, dass die Geschichte der serbisch-magyarischen Beziehungen reich an einer langen Tradition der gegenseitigen Unterstützung angesichts existenzieller Gefahren wie der osmanischen Eroberung Südosteuropas ist. Diese Botschaft ist heute hochaktuell, da unsere Länder von so ernsten Herausforderungen wie der Coronavirus-Epidemie und der Gefahr der Masseneinwanderung bedroht sind. Letzteres ist natürlich anders geartet als das, mit dem Ungarn und Serben vor sechshundert Jahren konfrontiert waren, aber es stellt ebenfalls ein ernstes Sicherheitsrisiko dar und kommt – wie damals – aus dem Südosten zu uns.
Wenn es so wichtig ist, auf diese Episoden der gegenseitigen Hilfe zurückzukommen, dann auch deshalb, weil die gemeinsame Geschichte unserer beiden Völker nicht immer frei von Konflikten, ja sogar von schweren Konflikten war. Leider enthält diese Geschichte der serbisch-magyarischen Koexistenz auch einige blutige Kapitel. Zwischen dem 16. und dem 20. Jahrhundert erinnern wir uns an mehrere schwere ethnische Konflikte, die unsere Beziehungen nachhaltig beeinflusst haben. Die Massaker in den ungarischen Siedlungen der Woiwodina während des Nationalen Befreiungskriegs 1848/49 haben sich ebenso unauslöschlich in das nationale Gedächtnis eingeprägt wie die Gräueltaten der Ungarn in der Woiwodina während des Zweiten Weltkriegs und die Kollektivstrafen in den ungarischen Dörfern am Ende jenes Krieges.
















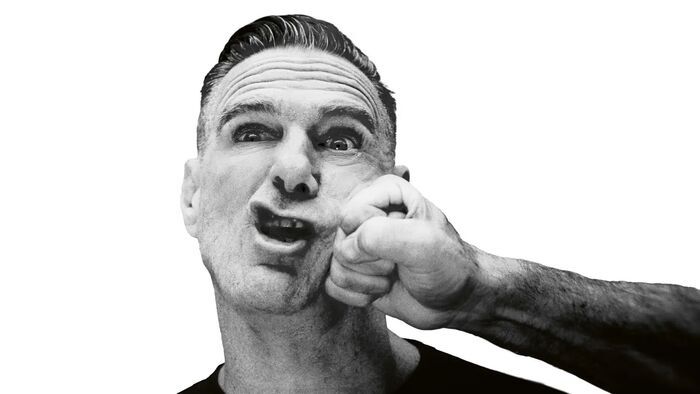


Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!