Um Ungarn bei seiner nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung zu unterstützen, analysieren wir ständig erfolgreiche Modelle in der Weltwirtschaft. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir den Ergebnissen von Südkorea, Israel, Dubai, Singapur, den Wunderstädten Chinas, Polen und den baltischen Staaten. Wir haben erkannt, dass die europäischen Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit (Bayern, Baden-Württemberg, Frankreich, Norditalien, Österreich, Schweiz, Skandinavien, Katalonien) keine Vorbilder mehr für die Entwicklung sind, weil auch diese einstigen Gewinnerregionen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht mehr mit den USA und Ostasien mithalten können.
Es gibt jedoch ein Beispiel in unserer Nähe, das wir bereits erkannt hatten, aber später aus den Augen verloren: Tschechien. Im Mittelpunkt unseres – inzwischen erfolgreichen – Wirtschaftsprogramms für 2010 stand die Schaffung von einer Million neuer Arbeitsplätze in Ungarn. Bei der Festlegung dieses Ziels haben wir uns an dem Beschäftigungsniveau in Tschechien orientiert, das unser eigenes um fast 1,2 Millionen Arbeitsplätze übersteigt.
Das tschechische Wirtschaftsmodell hat uns jedoch noch andere Lektionen zu lehren, so dass ein weiterer Vergleich zwischen der tschechischen und der ungarischen Situation gerechtfertigt ist. Wir werden dies aus drei Perspektiven tun:
- Was sind die Vorteile des tschechischen Modells, und wie können wir aufholen?
- Wo liegen die Vorteile des ungarischen Modells gegenüber dem tschechischen, dessen Überlegenheit noch gesteigert werden kann?
- Welche der zukünftigen Möglichkeiten, die entwickelt werden, könnten das ungarische Modell noch schneller und effizienter machen als das tschechische Modell?
Die Vergangenheit hat einen sehr starken Einfluss auf unsere gegenwärtigen und zukünftigen Möglichkeiten. Da wir die Vergangenheit nicht ändern können, können wir nur die Zukunft ändern, weshalb wir jetzt die notwendigen Schritte unternehmen müssen. Die Eigenschaften der Vergangenheit weisen auch eine merkwürdige Eigenschaft auf: Sie scheinen nach der Logik des „kumulativen Interesses“ zu funktionieren.








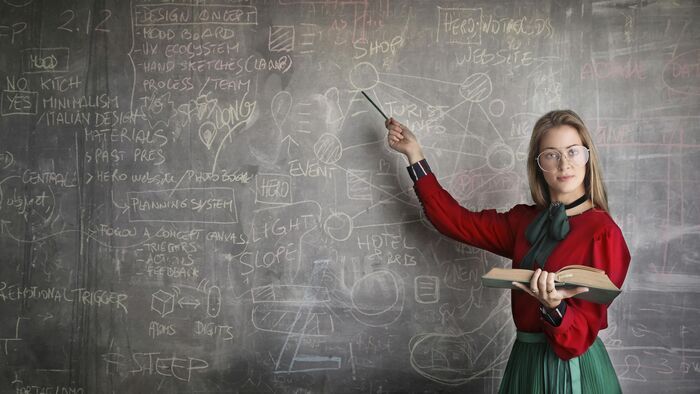










Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!