Haben Sie gehört, dass die slowakische Regierung um Verzeihung für die Beneš-Dekrete gebeten hätte, deren schändliche Bestimmungen die Grundrechte und die Freiheit der Bürger ungarischer Herkunft beschnitten, und ihr aufrichtiges Bedauern für die unschuldigen Opfer dieser Tragödie zum Ausdruck gebracht hätte? Wenn ja, dann haben Sie fast richtig gehört.
Die Bitte um Vergebung erfolgte öffentlich und unter Verwendung der genannten Ausdrücke, da die Regierung der Slowakischen Republik es als moralische Verpflichtung ansah, öffentlich ihr Bedauern für die von den slowakischen Behörden begangenen Verfehlungen zum Ausdruck zu bringen. Allerdings handelte es sich bei den erwähnten Missetaten (natürlich – wie man hinzufügen könnte) nicht um die Beneš-Dekrete, sondern um den vor achtzig Jahren erlassenen Judenkodex (Codex Judaicus auf Lateinisch, Židovský kódex auf Slowakisch), der die Juden aufgrund ihrer „rassischen“ Zugehörigkeit ihrer Rechte als Menschen und Bürger beraubte und sie von der Kultur und der Teilnahme an der Zivilgesellschaft ausschloss. Genau das, was sie vier Jahre später den ethnischen Ungarn (und Deutschen) antun sollten – zu einem Zeitpunkt, als die Tragödie der Juden bereits bekannt war.
Mehr noch: Der Versuch der ethnischen Säuberung durch die Beneš-Dekrete entsprach nicht (übereifrig) den ideologischen Erwartungen eines Reiches, wie es die Entscheidungen des slowakischen Marionettenstaates unter Tiso zur Zeit der Judengesetze waren. Im Gegenteil: 1945 gaben die Großmächte auf ihrer Tagung in Potsdam der Tschechoslowakei trotz ihres Drängens kein grünes Licht für die einseitige Vertreibung der Ungarn aus der Slowakei, sondern allenfalls für einen Bevölkerungsaustausch zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei. Dieser Misserfolg wurde durch Deportationen in Arbeitslager im Sudetenland kompensiert, während den verbliebenen Ungarn der Gebrauch ihrer Muttersprache verboten und ihre Schulen beschlagnahmt wurden.
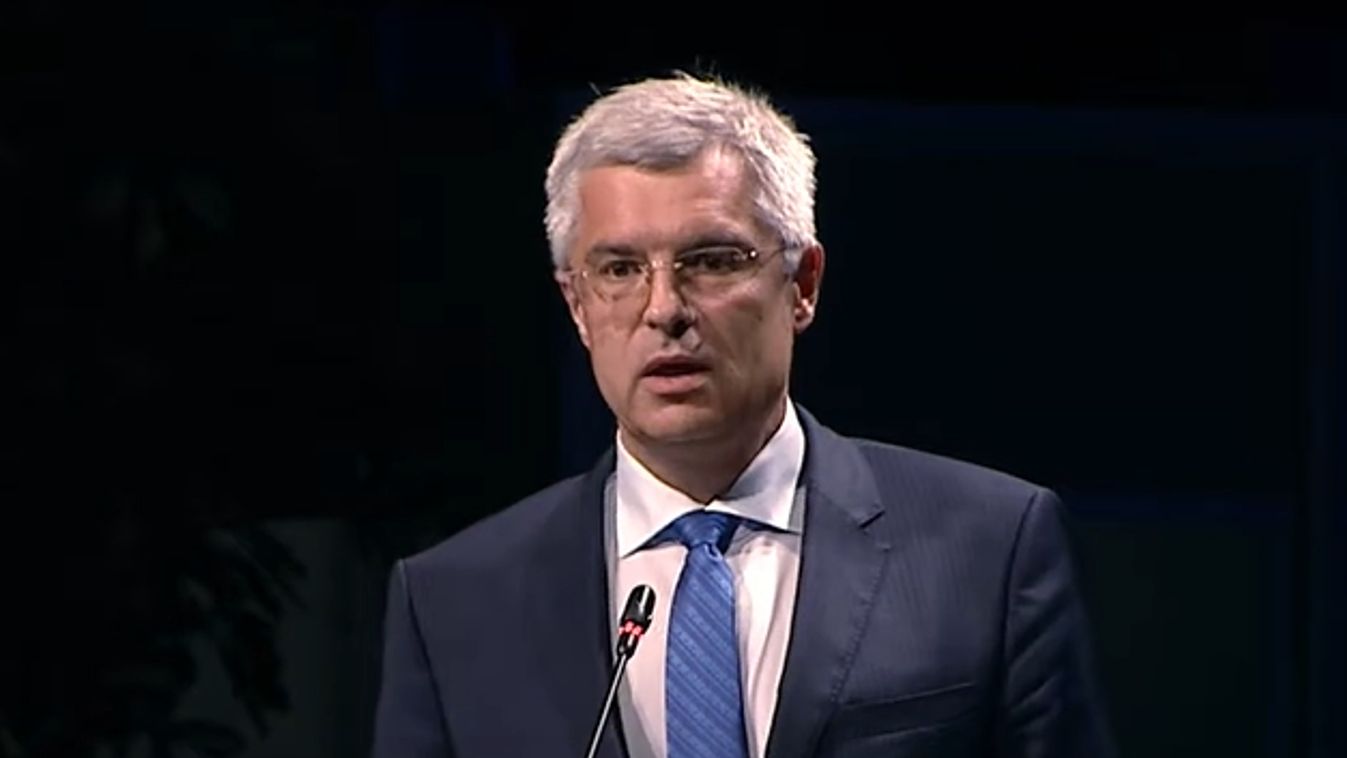



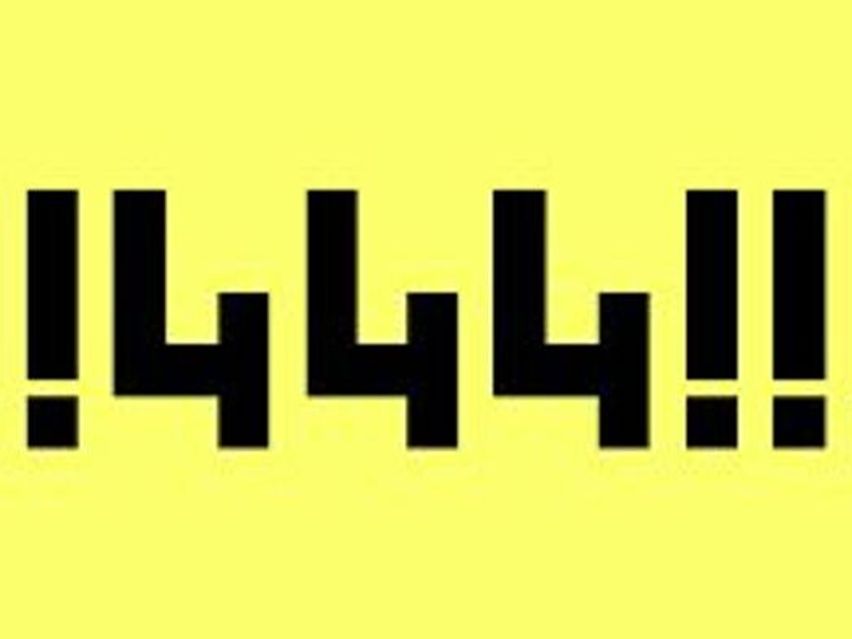














Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!